Im digitalen Alltag hinterlassen Kinder unzählige Datenspuren – oft ohne sich dessen bewusst zu sein. Diese unbedachte Preisgabe persönlicher Informationen gehört zu den unterschätzten Gefahren im Internet für Kinder. Besonders alarmierend: 96 Prozent aller 12- bis 19-Jährigen besitzen ein eigenes Smartphone, mit dem sie täglich Daten erzeugen und teilen.
Was Kinder unbewusst preisgeben
Die digitale Welt ist darauf ausgelegt, möglichst viele Daten zu erfassen – einerseits zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, hauptsächlich jedoch, um Geld zu verdienen. Kinder werden dabei auf verschiedene Weise zur Preisgabe persönlicher Daten verleitet:
- Bei Registrierungen und Anmeldungen: Vollständiger Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse werden abgefragt
- In Sozialen Netzwerken: Kinder posten Texte, Fotos und Videos, die Rückschlüsse auf ihre Persönlichkeit zulassen
- Beim Surfen und Spielen: Nutzungsdaten wie Besuchsdauer, aufgerufene Seiten und sogar Standortdaten werden im Hintergrund erfasst
- In Chats und Messenger-Diensten: Hier werden oft unbedacht persönliche Informationen geteilt
Besonders problematisch ist, dass auch beliebte Spiele-Apps für Kinder häufig mehr Daten erheben als für das Spiel notwendig wäre. Selbst bekannte Spiele wie “Pokémon Go” oder “Minecraft” sammeln übermäßig viele Daten und geben diese an Werbenetzwerke weiter. Außerdem ist erschreckend: Beim Spielen am Smartphone, Tablet oder PC werden Nutzerdaten wie Besuchsanzahl, -dauer und sogar Standorte meist unbemerkt erfasst und ausgewertet.
Warum harmlose Infos gefährlich werden können
Was auf den ersten Blick harmlos erscheint, kann schwerwiegende Folgen haben. Das Internet vergisst nicht – was einmal hochgeladen wurde, lässt sich kaum mehr vollständig entfernen. Außerdem gilt: “Ein Klick und die Daten sind weg, das kostenpflichtige Abo ist abgeschlossen”.
Zunächst ist wichtig zu verstehen: Das Private ist das Eigene, das nicht alle wissen sollen. Das Internet funktioniert jedoch wie ein öffentlicher Platz – nicht immer bekommen alle alles mit, aber es gibt Personen, die das Gesagte weitergeben. Dadurch können sich Texte, Bilder und Videos online verbreiten und mehr Menschen zugänglich werden, als ursprünglich beabsichtigt war.
Die Konsequenzen unbedachter Datenweitergabe sind vielfältig:
Identitätsrisiken: Nachname, Adresse, Telefonnummer und Schulangaben ermöglichen Rückschlüsse auf die Person. Sind diese Informationen einmal über das Smartphone verschickt oder im Internet veröffentlicht, können auch Fremde darauf zugreifen. Dies macht Kinder anfällig für Cybergrooming oder Belästigung.
Kommerzielle Ausbeutung: Nicht selten werden beim Surfen personenbezogene Daten wie das Surfverhalten erfasst, sodass Warenangebote gezielt auf junge Nutzer zugeschnitten werden können. Insbesondere bei Gewinnspielen geben Kinder oft bereitwillig ihre Daten preis, ohne die Folgen zu bedenken.
Langzeitfolgen: Es ist nahezu unmöglich, persönliche Informationen vollständig aus dem Internet zu entfernen – das Internet hat ein langes Gedächtnis. Selbst wenn ein Kind ein Video wieder löscht, können andere es bereits kopiert haben und anderswo wieder zeigen.
Cybermobbing: Die im Internet veröffentlichten Daten bieten eine beliebte Angriffsfläche für Cybermobbing. Einmal geteilte peinliche Fotos oder private Informationen können zum Ausgangspunkt für Belästigungen werden, da Cybermobbing direkt mit Datenschutz zusammenhängt.
Kostenfallen: Bei Apps und Spielen locken In-App-Käufe, die mit einem Klick ausgelöst werden können. Besonders Kinder sind sich oft nicht bewusst, dass sie dabei Kosten verursachen.
Besonders wichtig ist daher der sichere Internetzugang für Kinder. Allerdings gilt: Die Entscheidung, was privat bleiben soll und welche Daten für Anbieter und andere Nutzer verfügbar gemacht werden, folgt in der Regel einer pragmatischen Abwägung des eigenen Vorteils – eine Fähigkeit, die Kinder erst entwickeln müssen.
Datenschutz bei Kindern ist deshalb nicht nur eine Frage des Schutzes, sondern auch ein Freiheitsrecht, das angesichts der zunehmenden Risiken und Bedrohungen der Privatsphäre im digitalen Raum besonderen Schutz erfordert. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erkennt dies an und betont in Erwägungsgrund 38 ausdrücklich: “Kinder verdienen bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, da Kinder sich der betreffenden Risiken, Folgen und Garantien und ihrer Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten möglicherweise weniger bewusst sind”.
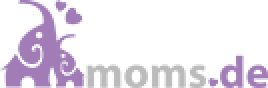

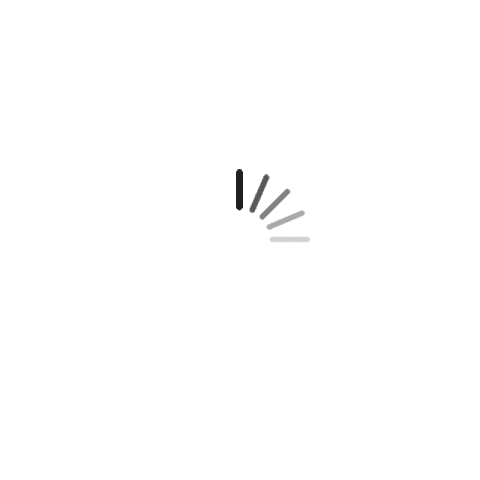
 23 Apr 2025
23 Apr 2025 5 Min.
5 Min.
